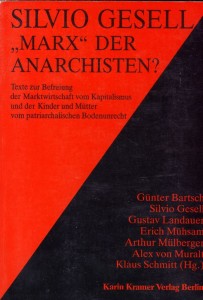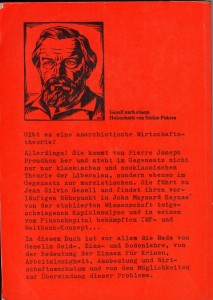Diese Erzählung handelt im weitesten Sinne von einem weit über hundertfünfzig Jahre altem Kommunikationsgerät, was in dieser Form auf unserer ERDENSCHEIBE im Aussterben begriffen ist, nämlich dem guten althergebrachten analogen Telefon, beginne allerdings beim tiefsten Urschleim.
Als Ostzonenableger wuchs ich in einem Haushalt auf, zu dem eine Anbindung an die große weite Welt gehörte!
Meine Großeltern nannten ein – noch aus Friedenszeiten stammendes – Telefon ihr Eigen. Was manchmal mehr Last als Freude darstellte, für unsere Familie oder den beiden bäuerlichen Nachbargehöften. Auf der anderen Seite in einer Mangelgesellschaft auch mit sehr vielen Vorteilen behaftet war, besonders für meine Schwester und mich, wenn wir den einen oder anderen Anwohner rasch benachrichtigen mussten.
Wir Kinder durften dieses kleine schwarze Wunderwerk nie selbstständig nutzen, auf der anderen Seite gab es in meiner Schulklasse sowieso fast niemand mit einem solchen Teil zu Hause.
Von Oma gab es immer mal wieder eine leichte Kopfnuss, wenn ich mich bloß mit „26 73“ meldete.
Dass mein Großeltern ein Telefon besaßen, ist dem Umstand zu verdanken, weil Opa ein hohes Tier in der Kupferhütte Artern war. Auch nach seiner Haftentlassung, dem vorherigen Kuraufenthalt in Bad Plötzensee, dann Zuchthaus Brandenburg, von 1935 bis 38, wegen Vorbereitung zum Hochverrat und anschließendem Berufsverbot bis Kriegsende, wurden jene Drähte trotzdem nie gekappt. Dies wollten erst die Kommunisten in den 1950ern nachholen. Großvater, bereits VdN-Rentner, ließ damals einen Spruch ab, als der seiner Tochter zugetragen wurde – einem herben stalinistisches Rotkäppchen – sprang sie daraufhin im Karree.
Opa hatte die Stare vom Fernmeldeamt gefragt, weshalb ausgerechnet die Kommunisten auf die Idee kämen, ihm das Telefon wegzunehmen. Was noch nicht einmal die Nazis versucht hätten, obwohl es sich bei ihm doch um einen gefährlichen Volksschädling handelte!
Spannend wurde es immer, wenn die Familienmitglieder, manchmal tagelang auf einen Klingelton vom Amt harrten. Nach einem in die weite Welt angemeldeten Ferngespräches oder alle auf ein angekündigtes Gespräch lauerten und die Stunden dabei sehr träge zerflossen.
Dabei war die weite Welt immer der Westen!
Bei sehr wichtigen Angelegenheiten wurde ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Der Wachhabende schlief dann nachts auf der Chaiselongue in Großvaters Arbeitszimmer. War das stressig an solchen Tagen, es durfte das Radio nicht eingeschaltet werden, Oma die oft bei der Arbeit sang, war nervös und mit einem Ohr immer in Richtung Telefon. Machbare Arbeiten wurden dann in Opas kleinem Reich erledigt, z. B. gewisse Vorbereitungen für das Mittagessen oder angesagte Putz und Flickarbeiten am großen Schreibtisch erledigt. Jedenfalls musste sich dann allezeit jemand in der Nähe dieses kleinen schwarzen Gerätes aufhalten. Einzig Opa ertrug alles mit stoischer Ruhe. Der stand dann stundenlang an seinem Stehpult neben dem Fenster und las, klingelte es, dann erfolgte der Griff zum Schreibtisch rüber. Niemals rastete er während seines Telefondienstes aus, schrie auch nie in den Hörer. Verließ allerdings immer kopfschüttelnd den Raum, falls die Verbindung unterbrochen wurde und die Frauen unter hysterischen Hallo-Hallo-Rufen, dabei wie von Sinnen, rhythmisch auf die Telefongabel droschen.
Als Kind waren für mich Telefonate mit Opas Freund aus Haifa immer das spannendste und unverständlichste, was diese Technik betraf. An solchen Tagen durfte ich mich in einem der Sessel vergraben und am Rauchtisch meine Schulaufgaben erledigen, ohne diese dezent aufdringlichen Kontrollen von Großmutter. Die folgenden Stunden verbrachte ich dann meistens mit Abpausen auf Pergamentpapier, aus Napoleons Werken. Stiche mit Schlachtenszenen, berittene Mamelucken, grimmig dreinschauende Osmanen die martialisch mit ihren Krummsäbeln hantierten oder irgendwas aus dem Brockhaus. Klingelte es, stand ich sofort am Schreibtisch vor dem Globus. Denn unbegreiflich, kamen fremdländischen Laute aus dem Hörer sonst wo her, aber nie direkt aus Israel. Manchmal hielt Opa die Muschel in meine Richtung und gab bekannt um welche Sprache es sich gerade handelte. In der Regel war nach wenigen Sätzen immer alles unterbrochen, wenn dann nur noch minutenlanges Rauschen oder Knacken erfolgte, wurde aufgelegt. Hinterher sofort auf dem Globus das Anschleichen jener exotischen Stimmen erörtert. Manchmal ging es wieder retour oder sie näherten sich im Zickzack. Die weiteste Verbindung, aber nicht immer die schlechteste, kam über London, Moskau, Warschau, Ost-Berlin, Halle und schließlich nach Sangerhausen…
Opa erzählte manchmal – nach Aussage seiner Tochter – großen Blödsinn, wenn er bemerkte, dass die Verbindungen nur deshalb immer so schlecht seien, weil sämtlich Geheimdienste der Welt sein kurzes Gespräch belauschen wollten. Daraus folgerten für mich merkwürdige Rückschlüsse, denn bei einem Anruf aus dem 50 km entfernten Halle oder einem Ort in der Umgebung war die Qualität teilweise noch mieser. Ganz zu schweigen bei dem Hin und Her der Verbindungen nach Hamburg und den ewigen Unterbrechungen dabei. Um ein Gespräch zu beenden, konnten schon viele Stunden ins Land gehen. Nicht zu vergessen, die dabei parallel auftretenden Geräusche, dauerndes Knacken, Kratzten, Rauschen, das 50 Herzt Brummen, sowie unerwünschte Konferenzschaltungen mit Babylonischen Stimmengewirr. Um es kurz zu machen, ein Telefongespräch war schon ein richtiges Abenteuer, unter bestimmten Umständen sehr spannend und facettenreich…
– Irgendwann, Anfang 1961, hatte gerade mit Radiobasteleien begonnen, da zapfte ich unser Telefon an, jener unerlaubte Informationsvorsprung ward nie zu unterschätzen! Dafür wurden lediglich zwei ganz dünne Drähte, von einem Trafo, an die Freileitung am Haus gerödelt. Unter den Dachziegeln verlegt, endeten sie vom Boden aus in meinem Zimmer, der entstehende Sound kam dann aus dem 2000 Ohm-Kopfhörer. Die ganze Kabelage am Fenster war für Laien sowieso nicht durchschaubar, da endeten zwei verschiedenartig ausgerichtete Langdrahtantennen und jeweils zwei Pärchen aus Sprenglitze vom Schacht, an denen unten zwei Lautsprecher hingen. Der eine befand sich im ehemaligen Scharraum der Hühner, wo nun meine Karnickelställe standen, die andere Leitung ging in den Garten, zu meiner Bude unterhalb der Hofmauer…
– Nach dem anschließenden Umzug in das südlich Gipsviertel, zwei Jahre später, folgte eine telefonlose Zeit. Im Wohnbezirk stand zwar eine Telefonzelle für kapp 1200 Einwohner, allerdings fehlte innen permanent das entsprechende Equipment. Im nach hinein kann ich mich überhaupt nicht erinnern, jemals dieses technische Wunderwerk intakt erlebt zu haben.
⸨Kein Wunder, plötzlich gab es die Animals, Beatles, Stones, aber in der Zone keine entsprechenden Gitarren.
Was wurde da gepfriemt, aus Reichsdeutschen Fundstücken kleine Verstärker gebaut, aus dem Zeug der Telefonzellen entstanden sowjetrussische Patente: Pickups für E-Gitarren.
Die seltsamste Form dieser Tonabnehmer bestanden aus 2000 Ω-Kopfhörern, die man an über den Körper der Konzertgitarre klemmte und damit sie nicht verrutschten, kam eine Fixierung mit Leukoplaststreifen. Dabei entstand ein Sound, der klang, als ob eine Ziege in einen Milcheimer schiss…
In der folgenden Datei findet man im letzten Absatz noch eine Bemerkung, zu meiner Gitarrenlehrerin im Heim. Sie brachte mir auch das perfekte Klimpern bei, es betrafen: If I Had a Hammer, Blowin’ in the Wind und The House of the Rising Sun. Dann endete meine Musikerkarriere, zu Beginn der 10. Klasse, sehr tragisch.
Hatte in den ersten vier Wochen, der letzten Schulferien, fast 1000 Mark verdient und verbrachte anschließend zwei Wochen bei meiner damaligen Freundin.
Ende September, zwei Monat vor meinem 16ten Geburtstag (Bin 9 Stunden älter als der segelohrige Dünnbrettbohrer aus dem Buckingham-Palast.), ereilte mich die schaurige Nachricht, dass ihre Erdbeerwoche ausgeblieben sei…
Der Rest wäre aber eine ganz andere Geschichte!⸩
Egal wo ich zu Zonenzeiten jobbte, jeder hielt sich die Leute mit Telefonanschluss nach draußen warm. Außerdem waren alle angeschissen, die sich während der Arbeitszeit nicht trauten die Arbeitsstätte zu verlassen, wenn nach fernmündlichem Zuruf, für mehrere Stunden irgendwo Bückware harrte, Bücher, Platten oder Klamotten. Ganz wichtig schien mir immer der Draht zum Pferdeschlächter, bei dem musste man in kürzester Zeit auf der Matte stehen. Zossen kamen ihm fast nur im Monatsabstand unters Messer, bei der unstillbaren Nachfrage, schon ein leichtes Problem, außerdem kostete alles verwertbare Zeug lediglich eine Mark das Kilogramm. (Für meine Pferdefleischköchelei besorgte meine Großmutter extra Töpfe und lagerte sie auch separat. Benutztes Werkzeug reinigte sie mit Todesverachtung und Abscheu sofort nach jedem Einsatz.)
Im altmärkischen Pfarrhaus (Ich zog dort mit zwei Kumpels im Herbst 1971 ein.) besaßen wir auch einen Anschluss, gedoppelt mit dem Förster. Wir kamen uns aber so gut wie nie in die Quere, da unsere Konversationen meistens in der Nacht stattfanden, wenn unsere Gesprächspartner im weiten Land, auf Spät- oder Nachtschicht relativ ungestört telefonieren konnten. Eine Bekannte arbeitete in einer Magdeburger Klinik und veranstaltete nächtens, stundenlange Konferenzschaltungen, sei es nur, dass sie zwei Hörer entsprechend aneinander hielt. (Nach dem Mauerfall stellten sich ganz nebenbei ihre ausgezeichneten Kontakte zu „Horch und Greif” heraus.)
– Dann begann, Oktober 1975, mein Aufenthalt in W-Berlin. Das Teflon wurde obligatorisch und alles bis Anfang der 1980er, 20 Pfennige die Einheit – allerdings 24 Stunden!
Da war es preiswerter, dass zwei Dauertelefonierer ihren Hörer nicht auflegten, nur eine Uhrzeit festlegten, wann es weiter gehen sollte. (Meggi war so jemand!) Allerdings konnte man in der Zeit nicht angerufen werden.
Da solche Wartezeiten nie automatisch unterbrochen wurden, es ging nur manuell vom Amt aus, nach aufwendiger Fehlersuche, ließen sich so Leitungen blockieren. (Damals eine beliebte Methode unter mittelständiger Konkurrenz, den anderen mehr als nur zu ärgern. In Stadtrand-Telefonzellen wurde die Gabel mit Holz richtig blockiert und der Zahlschlitz mit Alufolie verstopft.)
Diese Spielchen ließen sich nur umgehen mit einer neuen oder Geheimnummer. Das anschließende Freischalten mit neuen Ziffern kostete 24 Mark, nahm außerdem fast zwei Wochen in Anspruch. Fangschaltungen bei Telefonterror waren damals, bei gewöhnlich Sterblichen, überhaupt nicht denkbar.
Allerdings bestand die Möglichkeit sich mit der Störungsstelle in Verbindung zu setzen. Bei absoluter Stille an den Enden, jagte sie irgendwann mal etwas mehr Saft in die Leitung und es klingelte trotzdem. Da es auch geschah, dass der Hörer nicht richtig auflag. Später in der WG kam in die Zuleitung vor der TAE ein Schalter und der wurde nach erfolgreichen Suchanzeigen für Mitbewohner einfach betätigt.
– Auf Feten ließ sich meine Kenntnis über die gerade gültige Prüfnummer der Fernmeldemonteure lustig einsetzen, besonders in Wohnungen mit über 150 Quadratmetern und ellenlangen Fluren, wo sich das Telefon mit einem Reichsdeutschen Anschluss, natürlich an der Eingangstür befand. Ich wählte die entsprechenden Zahlen, legte auf, entfernte mich und nach 20 Sekunden begann es, bei einer intakten Leitung zu klingeln. Hob nun jemand ab, brach die Verbindung sofort zusammen und es folgte das Freizeichen. Jene Nerverei ließ sich noch erweitern bei reell erfolgenden Anrufen, indem man aus der Sprechmuschel das Mikro entfernte. Während sehr lauten Feten vernahm der Anrufer immerhin ganz leise Geräusche durch das Hörteil. Beide Teilnehmer fingen nun an zu brüllen, bis einer aufgab…
Einen Joker gab es für jemanden, der die ausgelaufene Nummer von einem viel benutzten Anschluss irgendwann mal erhielt. (Bis in die 90er war es für Normalsterbliche unmöglich, nach einem Umzug im Stadtbereich, seine alte Nummer mitzunehmen. Deshalb ließen sich anhand der Ziffernfolge, Rückschlüsse auf den entsprechenden Berliner Wohnsitz des Teilnehmers schließen.) Dies ging, 1990, einem Mädel mit meiner alten Schöneberger WG-Nummer so. Da sie das Geld für einen Neuanschluss sparen wollte und herausbekam, wer sich ehemals hinter ihren Zahlen verbarg, gelang es ihr schließlich, mich zu erreichen. Die Dame schien mit einem Sockenschuss behaftet zu sein, verlangte sie doch allen Ernstes, dass ich jeden Bekannten mitteilen sollte, wo ich neuerlich abgeblieben war. Monate später, nach einem Testruf meinerseits: Kein Anschluss unter dieser Nummer, sie hatte endlich investiert!
Aus Ostberlin klang das so: Berlin, Hauptstadt der DDR, kein Anschluss unter dieser Nummer…
Weiß aber nicht, ob es sich dabei nur um einen Spezialservice für Anrufer aus den Coca-Cola-Sektoren handelte.
Ab den 80ern, als in den Zellen erste, elektronisch nachgerüstete Telefone mit Displays aufkamen, bestand die Möglichkeit, Gebühren für Ferngespräche halbieren zu lassen. Da lungerten vor solchen Telefonzellen im Innenstadtbereich und +Berg manchmal Leute herum, die besaßen Innereien von piezoelektrischen Feuerzeugen, versehen mit zwei dünnen Kabeln. (Für jene Lighters legte man in jenen Tagen sehr viel Schotter hin, außerdem bewahrte der Fachhandel sie in verschließbaren Schränken auf.) Der Service dieser Jungs bestand darin, nach kurzer Rücksprache nebst kleinem Obolus, entsprechende Summen einzugeben, was sich absolut fair auf dem Display begutachten ließ.
Eine andere Möglichkeit, die Telefonkosten sogar zu vierteln, bestand darin, dass man die Münzer mit 5-Pencestücken fütterte. Absolut Identisch mit einer Deutschmark, stand deren Wert bei 25 Pfennigen. Noch bis in die 90er hinein fraßen Parkuhren, BVG- und Dattel-Automaten und sehr lange noch Pool-Billardtische gierig diese Währung.
(8. Juni, 1982, gegen 14:30, U-Bahnhof Blissestrasse – stoned wie ein Weltmeister – wollte mit meiner Freundin zu den Rolling Stones. Meine Barschaft bestand aus ungefähr 20 losen 5-Pencestücken in der Hosentasche, damit versuchte ich einen Viererfahrschein, für 4,50 DM?, zu erstehen. Eine Münze nach der anderen rutschte anfänglich durch. Mit etwas Spucke drauf, blieben beim anschließenden Durchgang, die verbleibenden zwei, endlich auch hängen. Rasselnd spie der Automat die Karte in das vorgesehene Fach, dann klimperte ein Geldstück hinterher, die 50 Pfennige Restgeld! Neeee, nee – auch etwas in einer leichteren Währung, es handelte sich um ein 50 Centime-Stück…)
Die Bundesbirne holte sich, ob dieser 5-Pencestücke bei UK-Maggie eine mächtige Abfuhr.Als er an sie appellierte, endlich jenen Münzen die Deutschmark-Identität zu nehmen. Sie antwortete ihm daraufhi, wenn er mit diesen Münzen Probleme hätte, dann solle er gefälligst etwas unternehme!
In den End70ern und den beginnenden 80ern war ich oft in London, mit zwei Übernachtungen am Wochenenden, für 99 D-Mark. In jeder Bank konnte man, gleich abgepackt, jeweils zu 100 Stück, 5-Pence erstehen. Durchgehend grinsten die dortigen Angestellten immer ganz dreckig…
War in der Zeit auch oft in Amsterdam, als man noch im Wondelpark pennen konnte, auch in den den niederländischen Banken gab es den entsprechenden Pence-Service. Wurden bei Stichprobenkontrollen im rollenden Korridor-Transit oder auf Flughäfen solche Mengen an UK-Münzen entdeckt, musste man sie, mit leichtem Verlust sofort zurücktauschen. Allerdings gab es auch die Möglichkeit einer Beschlagnahmebescheinigung und das Geld holte man sich dann auf einer hiesigen Bank retour…
Zum Folgenden, kurz einige technische Anmerkungen.
– Um bei alten Telefonen extern mitzulauschen, gab es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste, an fast allen Geräten konnte man eine zusätzliche Hörmuschel anschließen. In der Regel musste neben dem Anschlusskabel eine winzige Plastikabdeckung entfernt werden und schon ließ sich das zusätzliche Hörteil einstöpseln.
– Als nächstes, auch ganz einfach, es setzte aber den Betrieb eines externen Gebührenzählers voraus. Das kleine Kästchen stellte man in die Nähe eines Transistorempfängers, suchte kurz auf UKW die entsprechende Frequenz und schon ließ sich alles mithören.
– Ich lötete mir allerdings einen Adapter mit DIN-Buchse und stöpselte das Kabel in die Stereoanlage, optimal zur Verstärkung und Aufnahme. Weiterlesen →