Zur Erinnerung!
Um 1974 im Osten, dem ersten Schlaraffenland aller Arbeiter und Bauern auf deutschem Boden, bei 21 Tagen Grundurlaub, drei Wochen Urlaub zu machen, wurden die sowieso arbeitsfreien Samstage hinzugerechnet.
Drei Jahre später, nun bereits ein Jahr in der berühmten Firma Sonnenschein, im tiefsten Sumpf des Kapitalismus’ und deren, dort herrschenden Wolfsgesetze, gab es mit drei Tagen Erschwernis – 30 Tage zur Regenerierung – was vollen sechs Wochen entsprach. Mir reichte diese Zeit für einen Trip auf die immergrüne Insel nicht, ich wollte noch zwei Wochen unbezahlt, was aber nicht machbar schien. Zu eben dieser Zeit gab es allerdings in der Firma Kurzarbeit, dass hieß, täglich musste ein Kollege aus der Abteilung zu Hause bleiben. Nun kam mein listiges Proletenhirn zu dem Ergebnis, für alle Mitarbeiter diese schrecklichen, arbeitslosen Tage zu übernehmen, was täglich zwischen 50 bis 80 Mark Netto weniger in der Lohntüte ausmachten. Mein Vorhaben rief nicht gerade Begeisterungsstürme hervor, weder bei der Geschäftsleitung, noch bei den betroffenen Kollegen, vom Betriebsrat ganz zu schweigen.
Allen begann ich auf den Senkel zu gehen, schließlich gab mein Meister unter der Bedingung auf, wenn alle Kollegen mit meinem Plan einverstanden wären und der Rest sollte mit der Gewerkschaft abgekaspert werden.
Schließlich fanden es fast alle O.K, bis auf Hammerkarl. Mit selbigen lag ich seit geraumer Zeit schräg, wegen eines Kuckuckseis an dem ich mich beteiligt hatte.
Pille war auf diese Idee gekommen, weil er irgendwann, an seine Frühschicht noch acht Stunden dranhängen musste. Wir pappten eine Blechtafel von 1,5 mal einem Meter über Karls Arbeitsplatz. Befestigten das Teil mit Schwerlastdübeln an der Betonwand und schweißten zusätzlich die Schrauben noch am Blech fest. Von mir stammte die fein säuberliche Frakturschrift darauf:
Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd.
Doch Hammerkarl machts umgekehrt!
Schließlich gab der alte Suffschäddel, der immer wieder seiner größten Zeit bei der LAH (für Nichtwissende – Leibstandarte Adolf Hitler) nachtrauerte, auch das Einverständnis. Stotternd, wie immer, wenn ihn etwas aufgeregte: Duh, duh Stück Sah-sah-sachsenscheiße, duh! Du halber Ruh-ru-russe! Icke will dir ja nich im Weje stehn, weh-wenn du einem unserer Verbündeten ah-aus dem ersten Krieg einen Beh-besuch abstatten willst…
Von Pille, dem stellvertretenden Betriebsratsknecht erfolgte noch das letzte Wort. Schließlich trete die IG-Metall dafür ein, Arbeitsplätze zu erhalten und sollte nicht Urlaubsgeilen Ostlern bezahlte Kurzarbeitstage zuschanzen, so als verlängerten Urlaub. Als Gewerkschafter gab ich ihm sogar Recht und beim nächsten Billardtermin ein großes Bier nebst Wodka aus.
So konnte ich schließlich Ende April 1977, nach sechs Wochen Irland und anschließenden zwei in Wales, feststellen dass sich die Ebene auf der ich mich nun bewegte, mächtig verschoben hatte.
Da reichte es ein paar Jahre vorher noch aus, wenn ich auf dem Heimtramp, nachts im finstersten Halle/Saale fest hing, und mir sogar die 4 Mark 80 für die Rückfahrt fehlten, am nächsten Morgen im Zug den Schaffner zu bitten, mir ein Ticket auszuhändigen, das dann wenig später in Sangerhausen bezahlt wurde.
In Westeuropa war dann immer ein Euroscheck meine eiserne Reserve, wenn es mit dem Daumen partout nicht weiter ging. Dieses Bankpapierchen nützte einem allerdings auch nicht viel, wenn man sich beim Ausfüllen zu blöde anstellt, wie es mir in Wales erging. Dieser faux pas unterlief mir in Bangor auf einer Bank. Wieder einmal hatte ich seit Monaten meine Unterschrift verändert und es vergessen. Jener Krakel auf dem Scheck war deshalb nicht mit dem im Ausweis identisch, worauf mir logischer Weise kein Geld ausgezahlt wurde. Knapp kalkuliert schien die restliche Barschaft noch bis Dover über Liverpool zu reichen.
In der Nähe von Birmingham, ließen mich ein Wust von Schnellstraßen und Autobahnen schier verzweifeln, also bis zur Hauptstadt in den Zug. Anfangs in dieser Gegend, vielleicht auf 20 oder 30 Kilometern, rechts und links der Bahnstrecke ewig Industrieruinen auch aus dem letzten Jahrhundert…
In London wollte ich bei dem jungen Landlord eines Inders, den ich während meiner Tramptour in Irland kennen lernte, übernachten, der Typ sollte spottbillig seinen Wohnwagen vermieten. Als ich zu später Stunde im Ortsteil Wembley endlich das Haus fand, schlug Murphy zu. Im Garten nirgendwo ein Campingwagen, allerdings die Mini-Rasenfläche vom Rangieren total hinüber und in der Ausfahrt frische Radspuren. Mein Bekannter allein im Haus, wollte mich berechtigter Weise dort nicht nächtigen lassen. So als Entschädigung kam die Offerte zu einigen Pints in einem Nobelrestaurant.
Wieder auf der Straße, begann er mit sich zu hadern, denn es nieselte. Davon befreite ich ihn, als wir an einem Hinweisschild zum Stadion vorbei kamen und ihm kundtat, dort eine Penne zu suchen. Kurz darauf, just in dem Moment, als es, wie die Briten sich auszudrücken pflegen, Katzen und Hunde regnen begann, leuchtete auf der anderen Straßenseite das schummerig Entree eines kleinen Hotels auf, nichts wie rüber.
Mist, nirgends eine Klingel zu finden, also laut an den Türflügel pochen. Drinnen tat sich nichts, auch nicht, vom Geräusch der wummernden Fäuste, allerdings ging dabei langsam das Portal auf. Drinnen, vor dem Counter nahm ich auf meinem Rucksack Platz und begann zu rauchen. Anschließend erfolgten weitere Versuche mich bemerkbar zu machen, durch Rufen und klopfen auf die Schlagklingel am Tresen, nicht rührte sich. Nun wurde mir alles Scheißegal, ich wollte nur noch ratzen. Zündete noch einen Glimmer an und begann rum zuschnankern, gewahrte dabei hinter der Anmeldung eine Kellertreppe und kam auf die Idee, einfach runter zu gehen um mich dort breit zu machen. Egal was später geschehen würde, aber die Tür war verschlossen. Als ein weiterer Versuch scheiterte, mich bemerkbar zu machen, erfolgten weitere Erkundungen.
Ebenerdig, hinter der linken Tür befand sich ein kleiner Speisesaal. Gegenüber an der Stirnseite des Raumes, in einer Zieharmonikaholzwand noch ein Zugang, hinter der sich das gleiche Mobiliar wie im ersten Raum befand. Allerdings waren die Fensternischen mit dicken Stores verhangen und diese gemauerten Ausbuchtungen waren so gewaltig, dass man dort ohne weiteres auf einer Matte pennen konnte, ohne gleich gesehen zu werden, falls jemand den Raum betrat. In kürzester Zeit wurde das Nachtlager gerichtet.
Ich musste wie ein Stein geschlafen haben, als es draußen bereits hell war, ertönte Stimmengewirr aus dem vorderen Speiseraum und alle möglichen anderen Geräusche, die Gäste so veranstalteten, wenn sie sich das Frühstück einverleiben. Hinzu kamen gigantische Gerüche die umherwaberten.
Mit einem flauen Gefühl in der Magengegend, nicht nur wegen des Kohldampfes der sich einstellte, brach ich lautlos meine Zelte ab. Zog leise den Store etwas beiseite, platzierte den Rucksack an der Tür, hockte mich an einen Tisch und harrte der Dinge die da kommen sollten. Im Nachbarraum wurde es langsam immer ruhiger, es schienen dabei Stunden vergangen zu sein, was ich aber nicht korrekt nachvollziehen konnte, da meine Taschenzwiebel nachts den Dienst versagte.
Endlich trat Ruhe ein, außer dem leichten Geräuschpegel aus dem Vorraum, am Counter. Nun war es an mir, mich startklar zu machen. Richtete oben mit meinem zweigeteilten, fünfzinkigen Kamm die langen Fusseln, striegelte notdürftig den Bart und drapierte anschließend die Baskenmütze auf dem Haupt. Zupfte ordentlich die Hosenbeine der Jeans in den Springerstiefeln zurecht, kroch in den Parka, nahm einen tiefen Zug Whiskey, irischen Paddy, schob mir einen Riegel Kaugummi hinter die Kiemen, schulterte salopp meinen Rucksack – dabei kroch aber mächtiger Bammel in mir hoch.
Wie sollte ich den Raum betreten?
Vorsichtig die Tür öffnen oder alles forsch laufen lassen?
Also doch die zweite Variante!
Schließlich war es bei mir immer schon Gang und Gebe, illegal in niedlichen, kleinen englischen Hotels zu übernachten.
Also tief Luft geholt und durch…
Versucht lässig ging es an, trat aber keine zwei Schritte in den Raum, noch nicht mal die Klinke losgelassen und erschrak plötzlich, wie selten in meinem Leben.
Hinter dem halbgeöffneten Türflügel sprang jemand erschrocken auf, als er meiner ansichtig wurde, wobei der Stuhl krachend umschlug und brüllte mit überschlagender Stimme, als ob ihm der Leibhaftige erschienen war.
Bruchteile von Sekunden ging bei mir nichts mehr, dann kam es langsam. Da stand ein hutzliges, am ganzen Leib zitterndes altes Weib. Zu erst nahm ich von Gesicht und Hals, nur fettige, bepappte Falten war, ein riesiges Maul und drinnen ein vibrierendes Zäpfchen, nebenher dieses infernalische Gekreische. Besänftigend hob ich meine Hände, ungeschickter weise rutschte dabei mein Rucksack runter und knallte ihr vor die Füße. Was die Verrückte veranlasste, nach hinten zu torkeln, gegen den Tisch zu knallen und noch etwas nachzulegen mit der Lautstärke. Während ich mich nach dem Reisesack bückte und mit der verbleibenden Hand Beschwichtigungsversuche unternahm, kam mir kurz der Gedanke meine beiden Hände zu etwas anderen zu gebrauchen.
In diesem Moment wurde mir schlagartig klar, das es Individuen gab, die in solch einem Fall jemanden den Hals umdrehen mussten. Gott noch mal, wo nahm diese Vettel ihre Energie nur her? Den Rucksack schon wieder geschultert und ein paar Schritte von ihr entfernt, wurde sie immer wieder lauter wenn ich mich nur nach ihr umdrehte.
Nun kam mir endlich, wer da so infernalisch sang, die Braut musste eine ziemlich alte Amerikanerin sein. Ihre dünnen Beinchen steckten in unförmigen Latschen, der Körper wurde von einem gesteppten, schweinchenrosafarbigen Morgenmantel umhüllt. Riesige, knallrote Krallen und unförmigen Klunker zierten die pergamentenen Finger. In den grauen Haaren steckten viele, nun etwas aus der Form geratene Lockenwickler. Als ich das letzte Mal zu dem hysterischen Weib blickte, hatten ihre Ohren und sichtbare Teile des Gesichtes schon eine gefährliche Rötung angenommen, die mehr ins violette tendierten. Mit dieser Birne wäre sie glatt als Werbegag, für Mag Light oder Osramglühbirnen durchgegangen.
Nun war es an mir, mich darauf zu konzentrieren, was sich im vorderen Teil des Speisesaales und an der Rezeption abspielte.
Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass sich so viele Menschen in solch einem kleinen Hotel aufhalten könnten. Bestimmt an die 40 Leute glotzten mich an, wie in Bayreuth den Siegfried, allerdings niemand ausgesprochen feindlich, einige grinsten dabei recht unverschämt.
Jetzt lag es an mir, erst mal etwas auf bedeppert zu mimen, nichts verstehen vorgeben, um langsam wieder Oberwasser zubekommen. Ein schmächtiger Mann, in feinen Zwirn gekleidet, ungefähr in meinem Alter, Ende 20, versuchte gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Gab mir zu verstehen, am Tresen der Rezeption auf ihn zu warten, während er die nun endlich verstummte Gästin tröstete und sehr feinfühlig hinaus komplimentierte. Gleichzeitig versuchte die Menschenmasse im Vorraum durch Handbewegungen und sanfte Sprüche zu vertreiben. Gleichzeitig eine ältere umherwuselnde Dame besänftigte, die unentwegt nach der Polizei rufen wollte, bei der es sich um die Chefin und Mutter handelte, wie sich bald herausstellte.
Als wir uns endlich zu dritt, im geschlossenen Speisesaal wieder fanden, kam für mich eine Lehrstunde an englischen Umgangsformen.
Freundlich steif stellte der junge Mann sich und Mutti vor, nebenbei fischte er unbemerkt einen Aschenbecher, denn ich hielt mich schon wieder an einer Fluppe fest. Ihn irritierte etwas die Tatsache, dass ich partout nichts zu verstehen schien. In feinstem Englisch, mit einer Körpersprache, die der von Louis Trenker in keinster Weise nachstand, versuchte er herauszubekommen, weshalb ich im Gegensatz, wie er es normalerweise gewöhnt war, morgens mit Rucksack aus dem hinteren Speisesaal in Richtung Rezeption bewegte.
Schließlich gelang Junior, Mutti zu beruhigen. Die alte Dame kam absolut posh daher, plauderte in ihre Muttersprache, wie ich es aus Kindheitstagen nur bei den Sprachkursen der BBC erlebte. Deshalb verstand ich fast alles.
Die Seniorchefin versuchte zum Schluss nochmals ihren Sohn zu bewegen, dass er wenigstens meinen Rucksack auf Diebesgut kontrollieren sollte. Was er mir peinlich berührt darbrachte. Ich kam seiner Aufforderung nach und begann mein knirsch gepacktes Reiseutensil vor ihm auszubreiten, schließlich verzichten sie auf die gänzliche Kontrolle.
Es schien gelaufen, da wollte die Alte wenigstens noch einen Blick in meinen Pass werfen und alles begann von vorn. Dieses kleine grüne Ding, was ich ihr in die Hand drücken wollte, lehnte sie angewidert ab, den Berliner Behelfsmäßigen Personalausweis, ihr auch vollkommen unbekannt war. Sofort brachte sie wieder die Polizei ins Spiel. Nur gut, in diesem kleinen Teil gab es ja einen Hinweis in Englisch, schließlich schienen Führerschein und Scheckkarte sie halbwegs zu überzeugen.
Beide begleiteten mich dann an die Eingangstür, wobei Mutti im Vorraum stehen blieb, mich nur mit kurzem Nicken verabschiedete, sie schien die Welt nicht mehr zu verstehen. Ihr Sohn entließ mich mit einem Händedruck, “Es war nett ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, für die Übernachtung berechne ich heute nichts. Für die nächste Zeit sind sie uns ein willkommener Gast, aber dann melden sie sich bitte wie alle anderen Gäste an der Rezeption an! Ich wünsche ihnen einen weiteren angenehmen Aufenthalt in unserem Land.”
Die letzten beiden Tage meines Aufenthaltes im U.K. sind schnell erzählt.
Kurz kam ich noch in Konflikte mit mir, beim Anblick eines Posters. An bewusstem Tage sollte im Wembley-Stadion jene kalifornische Gruppe auftreten, die Jan & Dean so geil abkupferten und im ähnlichen Stil eigene Sachen verzapften. Dieses Problem erledigte sich aber von selbst, als ich in Soho, in einer Pizzeria mit bekam das es wieder zu schütten begann. Also, nix Beach Boys, sondern fürs letzte Geld ein Ticket nach Dover erstanden.
Wie sollte ich aber von der Insel runter, deshalb war am Fährhafen nach Calais wieder Kreativität gefordert.
In der Warteschlange guckte ich mir ein sehr junges Pärchen aus, von ihrer Rostlaube schloss ich auf eine bestimmte Lebenseinstellung, nebst Verständnis für mein Problem. Bei dem Typen setzte ich, was Menschenkenntnis anging, total aufs falsche Pferd. Es schien sich bei ihm um einen modisch gestylten Freizeithippie aus dem Bonner Raum zu handeln, außerdem auch noch Fan von ZDF-XY-Zimmermann: Man hört und liest ja so viel…
Dabei war mein Anliegen vollkommen risikofrei, allerdings mit leichtem Aufwand verbunden. Alles klappte doch noch, was ich seiner Freundin verdankte. Das Paar sollte meinen Rucksack, worin er Drogen vermutete, mit auf den Kahn nehmen, aber, wenn ich nicht kurz vor Abfahrt an Deck erschien, sie ihn mir wieder runter auf die Pier schmeißen sollten.
Nur gut, dass es sich beim englischen Königshaus um die Hannoveraner Linie und nicht die Preußische handelt. Die Genossen von der Pass- und Zollkontrolle schienen andere Sorgen zu haben, als friedliche Leute neugierig wegen ihrer Papiere zu belästigen. Aufs Schiff gelangte ich in mitten einer lustigen Meute belgischer Jugendlichen, in dem Chaos gaben die genervten Uniformträger sehr schnell ihre Versuche des Nachzählens auf.
Große Freude kam beim Chefhippie auf, als er mich endlich gewahrt, entschuldigte sich sofort wegen seiner kurz vorher geäußerten Vorbehalte: Sie wissen doch… Außerdem gibt es für solchen Fall, wie den ihrigen, Botschaften und Konsulate…
Ihn beeindruckte dann doch, dass es wirklich möglich schien, solche Institutionen nicht in Anspruch zu nehmen. Sein schlechtes Gewissen daraufhin oder sonst was, kam mir dann doch sehr gelegen. Anschließend auf See wurde ich regelrecht genötigt mir meine Wampe bis zum Abwinken, mit Köstlichkeiten aus ihrem Picknickkorb voll zuschlagen.
Einschließlich des späteren Lifts nach Aachen, empfing mich der Kontinent sehr lustig, allerdings verspürte ich keine Lust weiter zu trampen.
Deshalb rief ich vom Bahnhof aus S. an, die aus der Domstadt stammende, kleine, dickbrüstige, in Berlin stupidierende Fabrikantentochter, als politisch bewegte Langzeitstudentin vermutete ich sie zuhause, dem war auch so…
Sie organisierte sofort eine konspirative Geldübergabe. Innerhalb kürzester Zeit tauchte ein Freund von ihr auf und überreichte mir eine blaue Fliese für das Bahnticket. So rutschte ich auf einem Ritt, wieder in die eingemauerte Insel, mit allen diesen angenehmen Unterbrechungen, an Zaun und Mauer, die von mir, oft zum Entsetzen der Mitreisenden aufgelockert wurden.
Leider haben die wenigsten so abgekotz, wie ich es unaufhörlich tat…
PS.
Hatte mir besagten Termin deshalb ausgesucht, weil überall der Ginster und Rhododendron blühten. Trotz schwerer Bedenken eines Elektrikerkollegen, der vergangenes Jahr mit Kumpels eine 4wöchige Bootstour auf dem Shannon absolvierte und es fast die gesamte Zeit bärenmäßig schiffte. Sie ihre Zeit lediglich mit Saufen und Angelei verbrachten. Solch schauriges Wetter bleib mir in Irland die gesamte Zeit erspart, dies änderte sich erst in den letzten drei Tagen, als ich noch einen kurzen Abstecher nach Liverpool machen wollte…
– Ward das anschließend ein Stress, als ich mich nach acht sehr erlebnisreichen Wochen, wieder an die Maloche gewöhnen musste. Hatte ich doch auf der gesamten Insel Menschen aus allen sozialen Schichten kennen gelernt, von den Slums in Dublin bis hin zur High Society.
Alles begann gleich am ersten Tag meines Aufenthaltes mit einem Arbeitssaufen bei den Dubliners. Die Jungs hatten sich einen Kutter zugelegt und es war ein Tag Rostklopferei angesagt, zwar ohne Lohn aber saufen bis zum Abwinken…
Allein über diese wenigen Stunden hätte ich ein Buch schreiben können. Erst abends, recht trunken bereits, tolerierten alle die Tatsache, dass ich mit ihren Chauvinismus gegenüber den Briten nichts anfangen konnte.
Die nächsten drei Tage ging es mir absolut schlecht, nicht etwa von der Zecherei. Obwohl während der Arbeitszeit der Himmel total bewölkt war, hatte ich mir fast einen Sonnenstich eingefangen, den ich in den Wicklow Mountains auskurierte…
Immer wieder waren die Leute begeistert von meiner Trinkfestigkeit und ich mich traute eingängiges deutsches Liedgut vorzutragen, wozu in den Pubs die Musikanten oftmals mit einfielen. Es handelte sich dabei u.a. um: „Ein Mops kam in die Küche“, „Ein Schneider fing ´n Maus“ und „Zwei rosa Elefanten“. Oftmals holte ich auch irgendwann meine D-Dur Bluesharp hervor, dann war alles zu spät…
Regelmäßig wurden meine Sangeseinlagen natürlich mit Unmengen an Volksdrogen vergütet. Was die Sauferei betraf, war es letztlich der billigster Urlaub, den ich je im Ausland verbachtet – aber sehr ungut für meine Leber.
Als absoluter Kommunikationskatalysator stellte sich manchmal auch die Vorführung eines maskulinen Trinkerspielchens heraus, welches allerdings nicht nur in Irland zum Besten gegeben wurde. Wenn ich den Pint Bier in fast identischer Geschwindigkeit ohne zu schlucken runter stürzte, die meine Widerparts für einen doppelten Paddy benötigten…

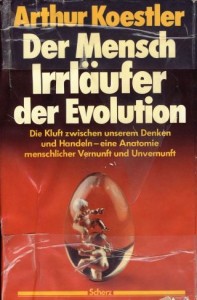


 Vier Jahre später, während meiner zehnten Klasse, vernahm ich folgenden Witz:
Vier Jahre später, während meiner zehnten Klasse, vernahm ich folgenden Witz: